Nachdem du nun weißt, wie eine Psychotherapie grundsätzlich abläuft (Teil 1: So geht Psychotherapie), geht es in diesem Artikel um einen besonderen Aspekt: die Behandlung von Positiv- und Negativsymptomen bei Psychosen.
Symptome einer Psychose können sich unterschiedlich zeigen. Manche Menschen haben intensive Erlebnisse und sind etwa überzeugt, verfolgt zu werden oder Stimmen zu hören (Positivsymptome). Andere leiden unter mangelnder Energie, fehlender Freude und wenig Kontakt zu anderen Menschen (Negativsymptome). Mehr Infos dazu findest du hier: Positiv- und Negativsymptome erklärt. Doch warum treten diese Symptome auf, und wie kann man sie mit kognitiver Verhaltenstherapie behandeln?

Symptome und Diagnose verstehen
In den ersten Sitzungen der Therapie geht es oft darum, herauszufinden, welche Symptome vorliegen und in welchen Situationen sie besonders auftreten. Dafür gibt es Gespräche, Fragebögen und manchmal das Einbeziehen von nahestehenden Personen. Ziel ist es, deine individuelle Situation zu verstehen und die Therapie darauf abzustimmen.
Typische Probleme von Betroffenen können sein:
- Ungewöhnliche Überzeugungen (Wahngedanken), Stimmenhören (Halluzinationen)
- Probleme mit Familie oder Freundeskreis (z. B. Misstrauen oder Streit)
- Schwierigkeiten in Schule, Ausbildung oder Beruf
- Ängste, Sorgen oder ständiges Grübeln
- Rückzug, Erschöpfung oder fehlende Motivation
- Traurigkeit oder Depression
- Schlafprobleme
- Wenig Selbstvertrauen, Scham oder Schuldgefühle
- Probleme mit Medikamenten
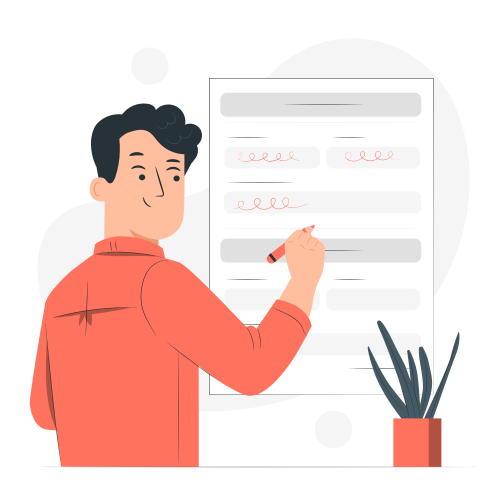
Ob Schizophrenie, Psychose, Wahn oder Negativsymptome – deine Therapeutin oder dein Therapeut wird dir die Diagnose erklären. In der Therapie werdet ihr euch vermutlich auf das Problem konzentrieren, welches dich gerade am meisten belastet.
❞

Wie entstehen Symptome einer Psychose?
Psychotische Symptome können verschiedene Ursachen haben. Manche Menschen sind besonders anfällig für Stress (zum Beispiel genetisch bedingt) oder treffen schnelle, unüberlegte Schlussfolgerungen. Das fördert die Entstehung von ungewöhnlichen Überzeugungen, die nicht der Realität entsprechen, sogenannte Wahngedanken. Belastende Erlebnisse wie Mobbing oder Traumata können ebenfalls eine Rolle spielen.
Mögliche Folgen sind:
- Ständig wachsam sein und das Gefühl haben, verfolgt zu werden
- Sich von anderen Menschen zurückziehen
- Bestimmte Orte aus Angst meiden
Stimmenhören kann durch Stress, Schlafmangel oder Einsamkeit verstärkt werden. Manche Betroffene sind überzeugt, die Stimmen kämen von außen, zum Beispiel vom Geheimdienst, was Unsicherheit oder Angst auslösen kann.
Negativsymptome wie fehlende Energie oder Vermeidung von Kontakten entstehen oft durch:
- Schlechte Erfahrungen während der Psychose
- Enttäuschungen im Kontakt mit anderen Menschen
- Geringes Selbstvertrauen
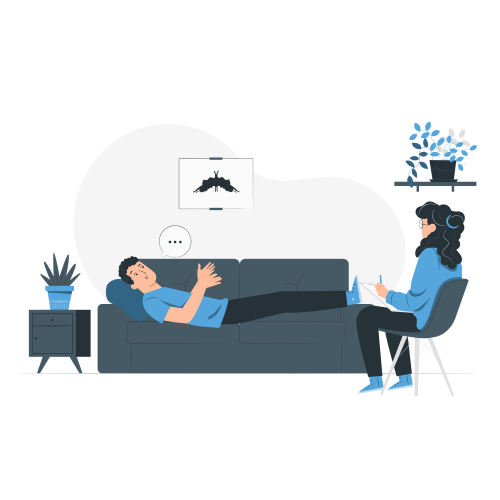
Strategien für den Alltag
Deine Therapeutin oder dein Therapeut wird für dich die passende Behandlung wählen, um deine Symptome anzugehen. Strategien für den Alltag können dir helfen, diesen in Zukunft wieder ohne therapeutische Hilfe zu meistern. Wichtige Methoden der Verhaltenstherapie sind:
Tagesstruktur aufbauen: Regelmäßige Abläufe und Schlafzeiten einführen
Positive Aktivitäten planen: Kleine Erfolge können das Selbstvertrauen stärken
Negative Gedanken hinterfragen: Neue Sichtweisen entwickeln und lernen, weniger zu grübeln
Mehr bewegen: Sport wie Yoga oder Krafttraining hilft bei Stress
Beziehungen zu anderen Menschen pflegen: Kontakte wieder aufnehmen und soziale Skills (z. B. Nein-Sagen) üben
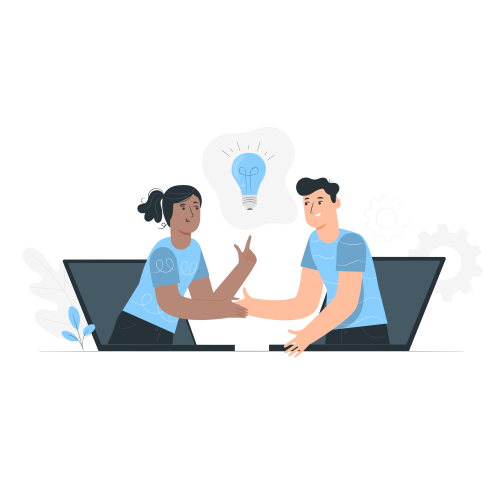
Diese Methoden helfen, wieder mehr Kontrolle über das eigene Leben zu gewinnen. Psychotherapie ist ein Weg, der Geduld erfordert, aber mit der Zeit Veränderungen bewirken kann. Es gibt noch weitere Aspekte wie Medikation und Rückfallprävention, die wir hier nicht besprechen konnten. Solltest du eine Therapie machen, kann dir deine Behandlerin oder dein Behandler sicher mehr dazu erklären.
Wir hoffen, der Artikel hat dir geholfen!
Betroffenen-Bericht: Joke erlebt mit 23 plötzlich eine Psychose – Diagnose Schizophrenie. Im kurzen Video-Portrait erzählt sie ihren Umgang mit der Erkrankung: Zurück ins Leben nach der Diagnose Schizophrenie.
Hinweis zu inklusiver Sprache
Unsere Inhalte richten sich an alle Menschen unabhängig von Geschlecht und Identität. Deshalb verwenden wir auf unserer Website sowohl neutrale, weibliche als auch männliche Formulierungen, während wir aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die gleichzeitige Verwendung dieser Sprachformen zum Beispiel durch das Gendersternchen verzichten. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Auch die verwendeten Bilder sind so gewählt, dass sie eine möglichst große Vielfalt abbilden.
